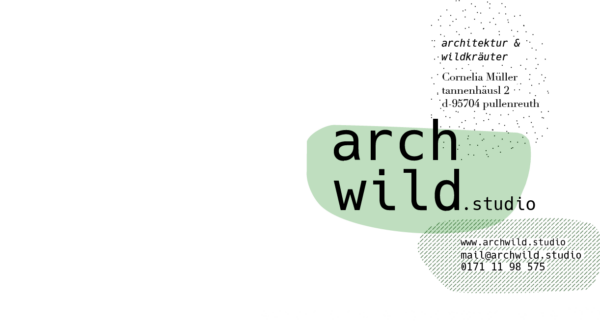22. April 2021
Der Bärlauch (Allium ursinum L.) – das Kreislaufkraut
Alexander Ernst ist der Kräuter-Detektiv unter uns. In seiner Detektei geht es um das Kraut – wie man es nutzen kann – als Apotheker und Genießer. Mitt was verbindet ihr Apotheker? Als kleine hagere Männer, die viel wissen und eine Nickelbrille tragen und kleinkrämerisch Dinge zusammentun. Das Bild des Apothekers hat sich heute sehr verändert. Alexander aber ist auf eine Art sehr traditionell – ihn interessieren die Wirkstoffe – die Apotheke ist gut, aber erfinden können wir nur was in der Natur schon angelegt ist. Mit dieser Sicht ist es interessant auch den Barläuch mal detektivisch unter die Lupe zu nehmen:

Mit seiner zwiebligen Schärfe, dem saftigen Grün der Blätter, den weißen, unbefleckten Blüten und dem frischen Geschmack weckt er auch das behäbigste Murmeltier aus dem Winterschlaf. Dabei ist die „Hexenzwiebel“ – einer seiner vielen Namen – nicht nur als Küchenspezialität in Form von Pesto, Bärlauchbutter und Co. eine wahre Spezialität, sondern wurde schon bei den alten Germanen und den Kelten sowie etwas später von den Römern als Heilpflanze gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen eingesetzt. Demnach lebten und leben Einwohner der Stadt Ramsau scheinbar besonders gesund, da der Bezug des Ortsnamens zur germanischen Bezeichnung für Bärlauch eine besondere Fülle an wildwachsenden „Rams“ suggeriert. Auch Karl der Große erkannte seinen Nutzen und ließ ihn schon im 8. Jahrhundert durch Erwähnen in seiner Verordnung „Capitulare de villis“ in den Klöstern anbauen.

Gerade in der heutigen Zeit, in der sich Bluthochdruck, Herzschwäche und Infarkte als die häufigsten Erkrankungen unserer Gesellschaft herauskristallisieren, kann Bärlauch wieder mehr an Bedeutung beim Vorbeugen gegen ebendiese Krankheiten gewinnen. Und für viele Wirkungen, die seit jeher geradezu intuitiv angenommen werden, ist in der Vergangenheit eine ordentliche wissenschaftliche Grundlage geschaffen worden: Besondere Moleküle, sogenannte Glutamylpeptide, also chemisch modifizierte Eiweißbausteine, wie sie hauptsächlich in der Familie der Lauchgewächse und am meisten im Bärlauch vorkommen, zeigen eine hemmende Wirkung an einem Enzym namens Angiotensin-Converting-Enzyme (ACE), das maßgeblich an der Steigerung des Blutdrucks beteiligt ist und auch schon von synthetischen Arzneistoffen zur Blutdrucksenkung (z.B. „Ramipril“) adressiert wird. Außerdem werden bestimmte Steroide im Bärlauch dafür verantwortlich gemacht das Zusammenlagern der Blutplättchen zu verhindern, weshalb sie auch als natürliche Blutverdünner verstanden werden können. Und als „i-Tüpfelchen“ schaffen es Extrakte des Bärlauchs – wenn auch bisher nur im Reagenzglas nachgewiesen – die körpereigene Cholesterinsynthese nach unten zu regulieren und somit den Cholesterinspiegel indirekt zu senken.

Zwar fehlen für diese Daten die großflächig angelegten, zur Bestätigung benötigten Studien, jedoch zeigen sie sein großes Potential und rechtfertigen den Einsatz in der Küche umso mehr. Diesen doch recht positiven Fakten steht eigentlich nur die Wirkung der hartnäckig im Mund-Rachen-Raum anhaftenden Schwefelverbindungen entgegen, die für störenden Ausstoß übelriechender Atemluft sorgen. Dennoch sollte Bärlauch im therapeutischen Sinne ungekocht verzehrt werden, weil die hitzeempfindlichen Peptide und Schwefelverbindungen durch Kochen zerstört werden. Um die blutdrucksenkende Wirkung nochmals zu verstärken, sollten die Bärlauchblätter bei einem gemütlichen April-Spaziergang durch duftende Wälder frisch gepflückt werden.

Zu beachten ist hierbei, dass es vor der Blüte zu Verwechslungen mit Maiglöckchen und Herbstzeitloser kommen kann, deren Blätter sehr ähnliche Form und Farbe besitzen und schon in geringen Mengen giftig sein können. Ist die Blattunterseite eher matt und man zählt nur ein Blatt pro Stiel, so handelt es sich sehr wahrscheinlich um Bärlauch. Eine eindeutige Unterscheidung kann aber durch einfaches Zerreiben der Blätter erfolgen, worauf sich in Falle des Bärlauchs der typische Zwiebelgeruch breit macht. Ob die Bären diese Methode ebenfalls anwenden, ist bisweilen nicht eindeutig geklärt. Es ist allerdings anzunehmen, dass sie im Laufe ihres Lebens eher weniger Probleme mit dem Herzen haben dürften und davon können wir uns gerne eine Scheibe abschneiden.
Text: Alexander Ernst
Redaktion: Cornelia Müller
Bilder: Startbild, Bild 2+3 – Cornelia Müller;
Bild 1 – Alexander Ernst
Quellen:
[1] Danuta Sobolewska, Irma Podolak, Justyna Makowska-Wąs, Allium ursinum: botanical, phytochemical and pharmacological overview, Phytochemistry Reviews volume 14, p.81–97(2015)
(2] Wolfgang Blaschek, Wichtl – Teedrogen und Phytopharmaka, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart, 6. Auflage, S.61f.
[3] Monika Kerner, Ulrich Dopheide, LBV-Artenwissen – Wildkräuter,
Hrsg. Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V., Umweltbildung Bayern, S.7
HINWEIS:
Die Erläuterungen, Steckbriefe, Rezepturen sowie Verwendungshinweise sind nach Überlieferungen der Volksheilkunde, nach eigenen Versuchen und nach bestem Wissen niedergeschrieben. Es bleibt in der alleinigen Verantwortung des Lesers, die Angaben einer eigenen Prüfung zu unterziehen. Werden Methoden, Ideen und Rezepte dieser Seite angewendet, dann geschieht dies auf eigene Verantwortung und Haftung. Anleitungen, Zubereitungen und Rezepte ersetzen weder eine ärztliche Diagnose noch eine entsprechende Therapie. !!!