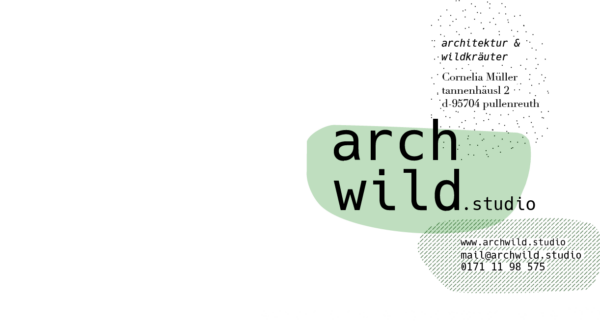01. Februar 2021
Lichtmess
Kirchlicher Hintergrund
Das Fest Maria Lichtmess stellte bis zum zweiten Vatikanischen Konzil in den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts das Ende des kirchlichen Weihnachtsfestkreises dar. Oft bleiben auch heute noch die Kirchenkrippen bis zu diesem Tag aufgebaut und die Christbäume in den Wohnzimmern stehen. Lichtmess ist die allgemeine Bezeichnung für den zweiten Februar, der bis 1912 ein Feiertag war. In der Sprache der Kirche heißt das Fest seit dem zweiten Vatikanum „Darstellung des Herrn“, davor „Maria Reinigung“. Nach alten jüdischen Regeln galt eine Frau, die einen Sohn gebar, 40 Tage nach der Entbindung als unrein und der Erstgeborene als Eigentum Gottes. Am Ende des Zeitraums musste die Frau ihr Kind in den Tempel bringen („darstellen“) und durch ein festgelegtes Opfer auslösen. Auch bei uns in der Oberpfalz war es bis ins 19. Jahrhundert üblich, dass eine Frau etwa acht Tage nach der Entbindung zur „Reinigung“ vor der Kirche erschien. In der Vorhalle wurde sie vom Pfarrer gesegnet. Erst dann durfte sie die Kirche betreten, Wachs, ein Opfertier oder Geld spenden und wieder am Gottesdienst teilnehmen.1
Früher waren am 2. Februar Lichterprozessionen üblich. Die Gläubigen zogen mit brennenden Kerzen in der Hand in die Kirche ein. Schon aus frühchristlichen Zeiten wird im Zusammenhang mit der liturgischen Feier von Lichterprozessionen berichtet, die wohl eine alte römisch-heidnische Sühneprozession verdrängen sollten. Etwa ab der Mitte des 5. Jahrhunderts war der 2. Februar in Rom ein hoher Festtag, an dem ein Umzug mit Kerzen und Fackeln stattfand.2

Kerzenweihe
An Lichtmess werden bis heute in der Kirche die Kerzenvorräte für das ganze Jahr geweiht – Kirchenkerzen und der private Bedarf. Früher brachte man neben Haushaltskerzen auch Sterbekerzen, schwarze Wetterkerzen und Wachsstöcke in die Kirche, ließ sie weihen und bewahrte sie als Vorrat für das Jahr zu Hause auf. Ein Wachsstock wird vom Wachszieher aus jeweils einem einzigen weichen und dünnen Kerzenzug gelegt. Ein altes Handwerk, das es heute kaum noch gibt. Wachsstöcke waren gerne empfangene Geschenke. Eltern beschenkten damit ihre Kinder, Dienstboten erhielten Sie von der Herrschaft. Der Knecht bedankte sich mit einem Wachsstock bei der Dienstmagd, die ihm täglich das Bett gemacht hat und seine Kammer in Ordnung hielt. Die besonders verzierten Stöcke hat man nie angezündet, sondern in kleinen Schachteln aufbewahrt. Auf die Schachteln notierte die Dienstmagd, wann und von wem sie den Wachsstock bekommen hatte. Die Bäuerin bedankte sich beim weiblichen Gesinde für deren Fleiß und Treue oft mit einem Wachsstöckl-Geschenk. Die einfachen Wachsstöcke hat man beim gemeinsamen Nachtgebet in den Bauernstuben, bei aufziehendem Gewitter und in der Kirche bei den Engelämtern (Rorate) angezündet.3
Heute findet man kunstvolle Wachsstöcke oft nur noch in Ausstellungen, wie im Stadtmuseum in Neustadt an der Waldnaab.
Eine besondere Bedeutung erhielt der 2. Februar, wenn er auf einen Sonntag fiel. Den an diesem Tag geweihten Wachsstöcken, schrieb man die zehnfache Kraft zu.4 Nach Franz Xaver von Schönwerth muss eine Weihe drei Jahre lang immer an jedem Tag, an dem Lichtweihe stattfand, wiederholt werden. Die so geweihten Wachsstöcke waren dann ein Familienstück und erbten sich von Stamm zu Stamm fort, oft hundert Jahre. Es sind nur drei Tage im Jahr, an denen die Wachsweihe stattfand: Lichtmess, Blasius und Agatha am 2., 3. und 5. Februar.5
Dienstboten
Ein besonders wichtiger Tag war Lichtmess für das Gesinde. In der Oberpfalz gab es für einen Dienstwechsel nur einen Termin im Jahr – Maria Lichtmess. Anderenorts konnte auch an Michaeli (29. September) gewechselt werden. Schriftliche Verträge gab es keine, es galt der mündliche Vorspruch und der Handschlag. Im Laufe der Zeit ging man dazu über, bei der Abmachung über ein neues Dienstjahr ein sichtbares Zeichen zu setzen. Bei den Oberpfälzer Dienstboten („Ehehalten“ genannt) war es üblich, ein Geldstück entgegenzunehmen, wenn man seinen alten Vertrag verlängerte oder einen neuen Dienst antrat. Das gesprochene Wort, die symbolische Geste des Handschlags und das Geld als Zeichen machten einen Dienstvertrag vollständig. Dabei nannte man das Geldstück in vielen Gegenden „Dingpfennig“ oder „Leykauf“.
In der vorindustriellen Zeit hatten die Mägde und Knechte die längsten Dienstverträge aller Arbeiter. Für ein ganzes Jahr mussten sie sich verpflichten, durften ihren Arbeitsplatz nicht früher verlassen und auch nicht früher gekündigt werden. Geregelt war dies in den Gesindeordnungen, die die bayerischen Herzöge und Kurfürsten zwischen dem 14. und 19. Jahrhundert erließen.
Freie Tage gab es für das Gesinde nicht, da es immer gebraucht wurde; auch an Sonn- und Feiertagen. Erst die Polizeiordnung von Herzog Maximilian im Jahr 1616 führt einen Dienstboten-Jahresurlaub von vier Tagen ein, „Schlenkelweil“, in der Oberpfalz eher „Kölbelweil“ genannt. Festgelegt auf zwei Tage vor und zwei Tage nach dem hohen Feiertag Lichtmess. Jetzt war Gelegenheit die Eltern und Geschwister zu besuchen, auf Kölbel-Tanzveranstaltungen und Schlenkelmärkte zu gehen oder in den Tafernwirtschaften zu zechen.6
Auf den Schlenklmärkten suchten die “Schlenklleut“ nach neuen Angeboten. Für die Bauern, die noch Dienstboten brauchten war einfach zu erkennen, wer noch frei war. Die Frauen trugen zweierlei Strümpfe, einen weißen und einen roten. Die Burschen hatten ihre Hüte mit einem Strohbüschel geschmückt. Lohn und Leykauf wurden genau ausgehandelt und mit einem kräftigen Handschlag besiegelt. Am dritten Tag nach Lichtmess, dem Agathentag, rückte die neue Magd oder der neue Knecht mit seinen Habseligkeiten an. Vielfach wurden die neuen Ehehalten von ihrem Dienstherrn mit dem Fuhrwerk abgeholt. Zur besseren Eingewöhnung gab es an diesem Tag auch einen besonderen Festschmaus, der meistens aus einem gut aufgeschmalzenem „Schmarrn“ (Mehlspeise) bestand.7
Erst Mitte des 18. Jahrhunderts bildete die „Ehehalten- und Tagwerkerordnung“ eine Grundlage, die in jedem Dienstbuch des Gesindes abgedruckt war. Der Dienstbote war verpflichtet, sich in das „Obrigkeitliche Dienstbotenverzeichnis“ eintragen zu lassen und ein vorschriftsmäßiges Dienstbuch zu führen.8
Der Barlohn der Dienstmägde fiel rund ein Drittel geringer aus als der, der männlichen Arbeitskräfte, wenngleich Frauen mitunter gleich schwere Arbeit verrichten mussten. Grundsätzlich kostenlos waren Unterkunft und Verpflegung; einfaches Essen und meist ein Bett unterm Dach. Eine warme Decke war oft selbst zu beschaffen.
Um 1930 verdiente Johann aus Brennberg 300 Reichsmark im Jahr, Mina aus Kallmünz erhielt 1917 120 Mark. Von diesem Jahreslohn, der an Lichtmess bar ausbezahlt wurde, war auch die meiste Kleidung, Schuhe und Toilettenartikel zu kaufen. Für Luxus wie ein Fahrrad musste Mina mehrere Jahre sparen.9

Mit Lichtmess begann ein neues Bauernjahr, die Winterarbeiten wie Besenbinden, Holzschuhe anfertigen und allerlei Ausbesserungsarbeiten waren für die Männer beendet. Seit St. Michael (29. September) haben sich die Frauen abends oft in geselliger Runde zusammengesetzt zum Spinnen, Stricken, Flicken oder Gänsefedernschleißen. Diese Treffen hießen Hutza-, Spinn- oder Rockenstubm.10

An Lichtmess räumten die Frauen ihre Spinnräder weg, die Arbeit draußen begann: „Lichtmess – das Spinnen vergess! ´s Radl hinter die Tür, die Hacke herfür!“11
Der Bauer prüfte an Lichtmess, ob der Heuvorrat noch bis zur nächsten Ernte reicht. War das nicht der Fall, wurde das Futter gestreckt. Da die Preise schlecht waren, wollte niemand zu dieser Zeit Vieh verkaufen. Also mischte man Haferstroh oder Roggenstroh unter das Heu. Das Stroh wurde sonst als Einstreu verwendet. Wenn auch hier der Vorrat zur Neige ging, brauchte man Ersatz. Also fuhr man in den Wald zum Streurechen. Dabei wurden verrottete Blätter und Nadeln, wie auch Schwarzbeerkraut mit eisernen Rechen ausgerupft, nach Hause gefahren und dort gelagert, bis das Stroh aufgebraucht war.12
„Lichtmess muss noch die Hälfte der eingebrachten Ernte vorhanden sein“.
Bauernweisheit
Unsere Vorkulturen feierten Anfang Februar die Wintermitte. Imbolc hieß dieses Fest bei den Kelten und war der Göttin Brigid geweiht. Sie war die Göttin der Poeten, Musiker und Künstler, sowie der Heilung und der Schmiedekunst. Sie war auch die Patronin der Hebammen und Schutzgöttin der Gebärenden.
Jetzt zu Lichtmess kann man das wiedergekehrte Licht in der Natur spüren. Die Tage werden länger und die Sonne gewinnt an Kraft. Pflanzen und Tiere erwachen aus dem Winterschlaf. Es ist die Zeit des ersten Keimens und des Neubeginns.

1 vgl. Steinbacher, Dorothea: Wenn es draußen finster wird. Bräuche und Legenden für die Winterzeit, 2. Auflage, 2020, S. 183
2 vgl. Schütz, Georg: Fest der Begegnung, in Erika und Adolf Eichenseer (Hrsg.): Oberpfälzer Weihnacht: Ein Hausbuch von Kathrein bis Lichtmess, 1978, S. 417.
3 vgl. Teplitzky, Hubert: Wachsstöckl, in Erika und Adolf Eichenseer (Hrsg.): Oberpfälzer Weihnacht: Ein Hausbuch von Kathrein bis Lichtmess, 1978, S. 419-420.
4 vgl. Schütz 1978, S. 418.
5 vgl. v. Schönwerth, Franz Xaver.: Wachsweihe um 1860, in Erika und Adolf Eichenseer (Hrsg.): Oberpfälzer Weihnacht: Ein Hausbuch von Kathrein bis Lichtmess, 1978, S. 418-419.
6 vgl. Hartinger, Walter: Dienstbotenurlaub an Lichtmeß, in Erika und Adolf Eichenseer (Hrsg.): Oberpfälzer Weihnacht: Ein Hausbuch von Kathrein bis Lichtmess, 1978, S. 422-424.
7 vgl. Herrmann, Josef: Beim Dienstbotenwechsel, in Erika und Adolf Eichenseer (Hrsg.): Oberpfälzer Weihnacht: Ein Hausbuch von Kathrein bis Lichtmess, 1978, S. 426.
8 vgl. Harbauer, Josef: Dienstbote und Dienstherr, in Erika und Adolf Eichenseer (Hrsg.): Oberpfälzer Weihnacht: Ein Hausbuch von Kathrein bis Lichtmess, 1978, S. 426.
9 vgl. Blumschein, Christine: Aus Gesprächen mit ehemaligen Dienstboten, in Erika und Adolf Eichenseer (Hrsg.): Oberpfälzer Weihnacht: Ein Hausbuch von Kathrein bis Lichtmess, 1978, S. 428.
10 vgl. Kuchler, Franz: Bäuerliche Winterarbeiten, in Erika und Adolf Eichenseer (Hrsg.): Oberpfälzer Weihnacht: Ein Hausbuch von Kathrein bis Lichtmess, 1978, S. 435.
11 vgl. Steinbacher 2020, S. 185.
12 vgl. Resch, Luise: Landwirtschaft um Lichtmeß, in Erika und Adolf Eichenseer (Hrsg.): Oberpfälzer Weihnacht: Ein Hausbuch von Kathrein bis Lichtmess, 1978, S. 431.
Bilder:
Startbild, 1, 2-Helmut Greger;
3,4 – Cornelia Müller